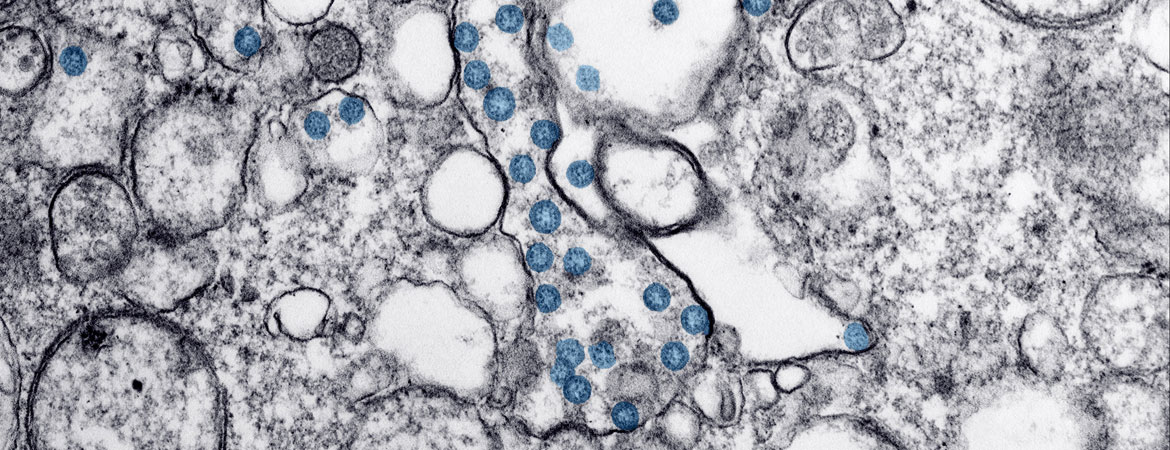Das Management der COVID-19-Pandemie war gekennzeichnet durch die Notwendigkeit, wichtige klinische und gesundheitspolitische Entscheidungen in einem bislang ungekannten Kontext von Ungewissheit und Zweifeln zu treffen: Was tun bei einem Patienten mit negativem Nasen-Rachen-Abstrich, jedoch erhöhter Vortestwahrscheinlichkeit für COVID-19? Welchem Patienten sollte Hydoxychloroquin verschrieben werden? Wie geht man mit Asthenie nach COVID-19 um?
Erste Bedenken kamen uns beim Blick auf die Situation in Italien, als von dort Mitte Februar 2020 die Meldung eines ersten Todesfalls im Zusammenhang mit COVID-19 kam. Eine Situation, die Anfang Mai 2020 mit fast 29 000 Todesfällen auf der Halbinsel eine tragische Entwicklung erfahren sollte. In der Schweiz wurde der erste COVID-19-Fall am 25. Februar 2020 in Lugano entdeckt, am nächsten Tag ein weiterer in Genf, und der erste Todesfall wurde am 5. März 2020 in Lausanne gemeldet. Bis Anfang Mai starben in unserem Land fast 1500 Menschen an COVID-19. Die lateinische Schweiz war also besonders von der Pandemie betroffen und, gemessen an der Bevölkerung, am stärksten der Kanton Genf, gefolgt von den Kantonen Tessin und Waadt. Die politischen, gesundheitlichen und organisatorischen Herausforderungen im Umgang mit dieser Pandemie waren ungewöhnlich gross. Die Fachleute im Gesundheitswesen zeigten ausserordentliches Engagement und Einsatzbereitschaft und mussten in Rekordzeit Lösungen zur Krise entwickeln.
Und so möchten wir in dieser Ausgabe des Swiss Medical Forum die Erfahrungen verschiedener Gesundheitsakteure besonders vom Coronavirus betroffener Kantone teilen. Die Texte sind bewusst kurz gehalten – wie auch die Zeit, die uns zur Verfügung stand, um zu reagieren und uns zu organisieren, kurz war.
Während die Pandemie viele Fachleute aus verschiedenen Bereichen mobilisiert hat, insbesondere solche aus der ersten Versorgungslinie, aus der Notfall- und Intensivmedizin und aktuell unsere geriatrischen Kolleginnen und Kollegen, konzentrieren sich die Beiträge dieser Ausgabe des Swiss Medical Forum auf die Herausforderungen, mit denen die ambulante und stationäre Allgemeine Innere Medizin konfrontiert war. Die Auswirkungen des Virus waren vielfältig und betrafen so unterschiedliche Bereiche wie Diagnostik, Klinikorganisation, Behandlungen, Kommunikation, Ethik und Forschung. All diese Aspekte mussten unter Zeitdruck angegangen werden, was manchmal zu Fehlern führte.
Wir leben in einem Land, in dem das Gesundheitssystem bei den Patientinnen und Patienten beliebt ist. Unser föderalistisches System gibt den Kantonen einen autonomen Spielraum. Es ist interessant festzustellen, dass die Massnahmen, die zum Pandemie-Management im klinischen Bereich und im Gesundheitswesen ergriffen wurden, in jedem unserer Kantone mitunter unterschiedlich waren. In der Tat waren die Strategien für Screening und Diagnostik, die Identifzierung und das Tracking von Kontaktpersonen, die Massnahmen zum individuellen Schutz in den Spitälern und die durchgeführten Therapien oft von Kanton zu Kanton verschieden. Die kantonale Autonomie in den organisatorischen Abläufen hat Vorteile: Entscheidungen werden schneller getroffen, was eine Anpassung und Reaktion entsprechend der lokalen Entwicklung ermöglicht, und die bürokratischen Abläufe sind verschlankt. Die kantonale Autonomie hat aber auch Schwächen: Die Kommunikation war nicht homogen und konnte zum Beispiel die Unsicherheiten in organisatorischen Abläufen erhöhen. Nehmen wir das Beispiel der Forschungsprojekte: Mehr als zweihundert Forschungsprojekte wurden Anfang Mai am Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), an den Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), am Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté) in Lausanne und am Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) initiiert, was das enorme Interesse und die Kreativität unserer medizinischen Gemeinschaft angesichts der von COVID-19 aufgeworfenen Fragen widerspiegelt. Die Entwicklung in der Krise hat es ermöglicht, diese Schwächen teilweise zu korrigieren, insbesondere dank einer besser koordinierten Kommunikation zwischen den Spitälern und der Zusammenführung von Forschenden mit redundanten Projekten. Es muss jedoch angemerkt werden, dass es bei vielen dieser Projekte an einer anfänglichen lokalen, nationalen oder internationalen Koordinierung mangelte. Verschiedene äusserst reaktionsschnelle Komitees haben es jedoch ermöglicht, die Koordination und Zusammenarbeit zu stärken. In diesem speziellen Forschungsbereich haben wir es nicht versäumt, den Empfehlungen unseres Bundesrates zu folgen: Forschungsprojekte wurden so schnell wie möglich eingereicht und so langsam wie nötig umgesetzt.
Wir hoffen, dass unsere hier geteilten Erfahrungen uns allen nützlich sein werden, um uns besser darauf vorzubereiten (und aus Fehler zu lernen), mit COVID-19 wahrscheinlich viele Monate oder sogar Jahre zu leben. Wir haben in der Anfangsphase der Pandemie ziemlich grosse Ungewissheit erlebt, solche Zweifel bestehen aber auch heute bei den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Lockerung der Beschränkungen.
Wir wurden von unseren verschiedenen Direktionen und der Bevölkerung stets begleitet und unterstützt. Wir möchten diese Zeilen auch nutzen, um unsere Dankbarkeit für die Unterstützung vonseiten der Politik, der Gesundheitsdirektionen, der Hochschul- und Spitaldirektionen, der zahlreichen klinischen Partnerinnen und Partner und natürlich all der Pflegefachpersonen, die grenzenlosen Einsatz gezeigt haben, zum Ausdruck zu bringen.
Die Autoren haben keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.
Prof. Dr. med. Gérard Waeber
Chef du Departement de Médecine
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Rue du Bugnon 46
CH-1011 Lausanne
Gerard.Waeber[at]chuv.ch
Veröffentlicht unter der Copyright-Lizenz.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Keine kommerzielle Weiterverwendung ohne Genehmigung.
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/